„Historische Grenzen wirken oft bis heute nach“
In ihrem neuen Buch „Das Phantom der alten Grenze am Zbruč“ untersucht Sozialgeographin Sabine von Löwis eine heute fast vergessene Grenze im Westen der Ukraine. Sie zeigt, wie vergangene Grenzräume situativ wieder auftauchen. Ein Buch über Erinnerung, Zukunftserwartung, Raum und Zugehörigkeit.
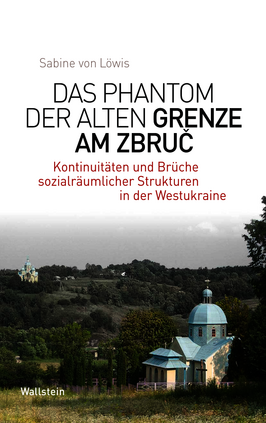
In Ihrem Buch geht es um die Grenzen am Fluss Zbruč, die heute kaum jemand außerhalb der Ukraine kennt. Warum ist gerade diese historische Grenze so spannend und erzählenswert?
Zum einen, eben weil die ehemalige Grenze am Zbruč so unbekannt ist. Und vor allem, weil sie, wie andere historische Grenzen im östlichen Europa, in aktuellen Phänomenen, wie zum Beispiel gelegentlich im Wahlverhalten, wieder auftaucht. Das war ein Indiz, das mich dorthin geführt hat. Solche Muster kennen wir auch aus Deutschland – die ehemalige innerdeutsche Grenze scheint in Wahlen immer wieder neu hergestellt zu werden. Das Forschungsprojekt, in dessen Rahmen diese Arbeit entstand, beschäftigte sich mit sogenannten Phantomgrenzen im östlichen Europa. Historische Grenzen wirken oft bis heute fort. Ich habe mich auf die Ukraine konzentriert, weil sie damals, vor dem Kriegsbeginn 2014 in der Ostukraine, wissenschaftlich wenig beachtet wurde. In der Ukraine gibt es zwei prägende Flüsse: den Dnipro, der stark politisiert ist, und den Zbruč, der weniger aufgeladen, aber im intellektuellen Diskurs und auch in der Alltagswahrnehmung präsent ist. Gerade seine Unscheinbarkeit und die geringe wissenschaftliche Auseinandersetzung machten ihn für mich spannend.
Wie haben die Menschen, die an dieser Grenze lebten, die politischen Veränderungen erlebt – und wie prägen diese Erfahrungen ihre Identität bis heute?
Ich habe in zwei Dörfern geforscht, ohne die ehemalige Grenze explizit anzusprechen, um zu sehen, ob und wie sie im Alltag auftaucht. In den ersten Gesprächen wurde sie immer wieder erwähnt: „Hier war auch eine Grenze.“ Den Menschen ist ihr historisches Bestehen bewusst, aber sie stellen unterschiedliche Bezüge dazu her. Hier wurden in der Vergangenheit mehrere Grenzen gezogen – etwa nach den Teilungen Polens zwischen dem Habsburger und dem Russischen Reich oder nach dem Ersten Weltkrieg zwischen Polen und der Sowjetunion. Kaum jemand hat die älteren Grenzen erlebt, aber Erzählungen, Zuschreibungen und historische Assoziationen werden nach wie vor im Diskurs oder im Austausch hergestellt. Identität wird flexibel gehandhabt, dennoch gibt es Bezeichnungen wie „Galičani“, „Banderivci“ oder „Moskali“, die historisch, politisch und kulturell unterschiedliche Bedeutung haben und die die Bewohner*innen beider Seiten füreinander verwenden. Obwohl die Bevölkerungsstruktur auf beiden Seiten ähnlich ist, wird das Gegenüber oft mit anderen politischen oder kulturellen Prägungen verbunden –z.B. mehr oder weniger demokratisch, kollektiv oder patriotisch. Auch wirtschaftliche Unterschiede werden narrativ erklärt, obwohl sie sich real kaum unterscheiden.
Sie sprechen von „Phantomgrenzen“ – was bedeutet das eigentlich, und wie können solche alten Grenzen auch heute noch unser Denken über Räume und Zugehörigkeit beeinflussen?
„Phantomgrenzen“ ist eine Metapher, um vergangene politische Grenzen zu bezeichnen, die heute nicht mehr aktuell sind, aber in unterschiedlicher Form wieder auftauchen können – etwa in Institutionen, Routinen, Praktiken oder Raumvorstellungen. Sie sind nicht permanent sichtbar, sondern erscheinen und verschwinden je nach Kontext. Das ist das Phantomhafte: Sie sind manchmal da und manchmal eben nicht. Sie sind nichts Permanentes. Es handelt sich nicht um ein statisches Raumverständnis, sondern um eine Aktualisierung durch Diskurse und Narrative, institutionelle Kontinuitäten oder historische Bezüge wie „Das war doch Habsburg“ oder „Das war Polen“. Entscheidend ist zu verstehen, wann und warum solche Grenzen und gesellschaftlichen Ordnungen wieder relevant werden. Auch heute lassen sich diese Effekte beobachten – etwa in Deutschland zwischen Ost und West: im Wahlverhalten, der Versorgung mit Kitas oder in Einstellungen zur frühkindlichen Betreuung. Die Rekonstruktion solcher Grenzen, gerade auch der ehemaligen innerdeutschen, ist dann oftmals auch Teil politischer Agenden. Phantomgrenzen – Assoziationen mit vergangenen politischen und gesellschaftlichen Ordnungen – tauchen in Strukturen und im Denken auf, werden manchmal überschrieben oder vergessen und erscheinen später erneut, wenn Vergangenes wieder ins Spiel gebracht wird.
Gibt es andere Orte in Osteuropa, an denen ehemalige Grenzen ähnlich starke Spuren hinterlassen haben?
Es gibt den polnischen Fall, wo man die Aufteilung Polens zwischen Preußen, Russischem Reich und Habsburger Reich sehr gut sehen kann – etwa in Regionen des ehemaligen Galiziens. Menschen greifen die Habsburger Zeit aktiv auf, markieren frühere Grenzverläufe und schaffen kleine Museen oder Erinnerungsorte. Diese Formen der Erinnerung haben eher einen musealen Charakter: Es geht weniger darum, ob die alte Grenze das Verhalten heute noch prägt, sondern um eine bewusste Sichtbarmachung der Geschichte. Aber auch viele offene Fragen bleiben, wie zum Beispiel das wiederkehrende Bild der Teilungsgrenzen im Wahlverhalten in Polen, dem Schienennetz oder der Agrarstruktur im Land.
Was kann uns das Wissen um vergessene Grenzen wie die am Zbruč lehren?
Meine Studie zum Zbruč zeigt, dass man keine vorschnellen Schlüsse ziehen und ohne weiteres von irgendwelchen Kontinuitäten ausgehen sollte. Etwa die Annahme: Dort wählt man proeuropäisch, weil es früher Habsburg war – und dort weniger europäisch, weil es einige Jahre länger zur Sowjetunion gehörte. Das sind oft Kurzschlüsse. Man muss genauer hinschauen: Wie werden Wähler*innenstimmen motiviert, wie werden Vergangenheit und Zukunft in Wahlversprechen oder Diskursen verknüpft und wie situativ sind Formulierungen von Identität? In einem Moment wird die Zuweisung „Galičani“, im nächsten „Moskali“ verwendet – je nach Kontext und Abgrenzungsbedürfnis. Das Verhalten ist stark vom jeweiligen Rahmen geprägt. Auch hier zeigt sich das Phantomhafte alter Grenzen: Sie tauchen in bestimmten Situationen auf – etwa durch Herausforderungen oder Mobilisierung – und verschwinden in anderen wieder. Es gibt keinen vorherbestimmten Verlauf im Sinne von: „Weil es früher so war, ist es heute auch so“ oder „Die Vergangenheit setzt sich in die Gegenwart fort“. Bezüge zur Vergangenheit werden immer aus benennbaren Gründen hergestellt. Genau deshalb braucht es differenzierte, kontextbezogene Analysen. Vergangene Ordnungen überlagern sich, aber nicht vollständig. Manche Elemente gehen verloren, andere werden immer wieder aufgegriffen und fortgeführt, aber unter anderen Vorzeichen oder auch mit anderer Bedeutung.
Das Interview führte Angelika Markowska, Volontärin am ZOiS.
PD Dr. Sabine von Löwis ist Sozialgeographin am Zentrum für Osteuropa- und internationale Studien, wo sie den Forschungsschwerpunkt „Konfliktdynamiken und Grenzregionen“ leitet.
Von Löwis, Sabine. Das Phantom der alten Grenze am Zbruč: Kontinuitäten und Brüche sozialräumlicher Strukturen in der Westukraine. Reihe: Phantomgrenzen im östlichen Europa; Bd. 7. Wallstein Verlag, 2025.